In der Schweiz hatte man sich dem Thema Taucheruhr vergleichsweise früh angenommen, allen voran die beiden Pioniere Blancpain und Rolex, und hatte dank Verträgen und Partnerschaften mit Militär und Forschung auch bereits regen Austausch mit Praxisanwendern. Rolex und auch Omega erkannten dabei früh, dass „Berufstaucher“ ein etwa gleich schwammiger Begriff wie „Profi-Athlet“ war und suchten den Kontakt zu möglichst vielen unterschiedlichen Gattungen von Tauchern, was unter anderem auch zur Partnerschaft mit der 1961 gegründeten und auf Tiefsee-Erforschung spezialisierten Compagnie Maritime d’Expertise (COMEX) in Marseille führte (die später exklusiv mit Rolex weitergeführt wurde). Sowohl Omega als auch Rolex mussten dadurch schnell einsehen, dass die bisherigen Taucheruhren nur bedingt für die Anforderungen des seit 1965 kommerziell verfolgten Sättigungstauchens (bei dem Taucher über längere Zeit in Druckkammern oder Taucherglocken sind und nach Abschluss der Arbeiten nur langsam dem Oberflächendruck ausgesetzt werden) geeignet waren: Den simulierten Aufstieg in der Überdruckkammer überstanden nicht alle Uhren unbeschadet. Was war passiert? – Der langsam abnehmende Umgebungsdruck in der Kammer und die im Innern des zwar wasserdichten, aber mit Helium gesättigter Luft gefüllten Gehäuses der Uhr führten in einzelnen Fällen dazu, dass die Fassung des Glases nachgab und sich selbiges löste.

Rund 10’000 km entfernt machte Seiko die selbe unangenehme Entdeckung: Ein Berufstaucher aus Kure, einer Hafenstadt in der Präfektur Hiroshima, hatte sich 1968 mit einem Brief an das Unternehmen gewandt und darauf hingewiesen, dass Einsätze in 350 Metern Tiefe nach robusteren Uhren verlangten, als Seiko zu diesem Zeitpunkt im Angebot hatte.
Der Unterschied zwischen einer Uhr für Taucher und einer Uhr für Sättigungstaucher zeigt sich im Falle von Seiko besonders eindrücklich: der British Sub-Aqua Club (BSAC) hatte im selben Jahr der Marke noch attestiert, als einzige (von 17 getesteten Herstellern) „zu 100% sicheren Schutz vor Wassereinbruch zu bieten“ und mit einer 80% Zufriedenheit Seiko den zweithöchsten Wert innerhalb des Praxistests von herkömmlichen Taucheruhren attestiert. Aber zurück nach Tokyo: Für die japanischen Entwickler war die Nachricht aus Kure ein Weckruf, der dazu führte, dass das Unternehmen während der folgenden 7 Jahre an einer Uhr für den professionellen Einsatz arbeiten sollte. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, eine für extreme Taucheinsätze ausreichend robuste Uhr zu bauen und darauf ein eigenes Team angesetzt.

Ähnliches geschah bei Omega im Jahr 1966, und während die Marke ebenfalls weiterhin Taucheruhren verkaufte, wurde 1970, nach vierjähriger Entwicklungszeit, eine radikal gestaltete Uhr in den Handel gebracht, die das Thema „Taucheruhr“ von Grund auf neu anging: Die Seamaster 600 „Ploprof“ (franz. Plongeur Professionel) wurde damit zur ersten Extremtaucheruhr. Die Ploprof war mit einem ungewöhnlichen Monobloc-Gehäuse ausgestattet, das so stabil mit dem Glas verbunden war, dass selbst Sättigungstauchgänge damit möglich wurden. Omegas damaliges Fazit:
„We also put the 600 through our helium test. Helium, having much smaller molecules, can penetrate where water can’t. So if a watch is proof against helium, it’s proof against just about everything else.“
Seiko folgte vier Jahre später mit der offiziell ebenfalls bis 600 Meter wasserdichten, heute umgangsprachlich als „Tuna“ bekannten Uhr der Prospex-Reihe (engl. Professional Specifications), welche auch die 6159-Referenz-Nummer weiterführen sollte), einer technologisch noch revolutionäreren Uhr (mit Einschalen-Gehäuse und zusätzlichem Gehäusemantel), die wie die Ploprof weit über das von Sättigungstauchern verlangte Mass hinausging (die Ploprof wurde bis 1’200 Meter Tiefe getestet, die Seiko im Jahr 2014 bis über 3’000 Meter). Beide Uhren setzten dafür Funktion über Form und verfügen deshalb über ein Design, das bis heute als ungewöhnlich bezeichnet werden kann:



Rolex ging indes einen völlig anderen Weg: Zwar arbeitete man ebenfalls an robusteren Gehäusen, aber grundsätzlich verfolgte man einen viel pragmatischeren Weg – nicht unähnlich der charakteristischen Lupe über dem Datum (während mancher Hersteller seiner Kundschaft ein grösseres Datum anbieten wollte und am Werk zu arbeiten begann, klebte Rolex kurzerhand eine Lupe aufs Glas und erklärte das Problem für gelöst): Bei der Taucheruhr setzte man auf ein seitlich integriertes Einwegventil, das die Wasserdichtheit der Armbanduhr nicht beeinträchtigte. Die 1967 patentierte Konstruktion mündete in der Sea-Dweller (und bei Doxa in der Conquistador), einer vergleichsweise normal gestalteten Uhr, die nun aber auch für extreme Anforderungen bestens gerüstet war.
Ergo: es gibt kein Richtig oder Falsch beim Einbau eines Heliumventils; es gibt Marken, die historisch betrachtet keines verbauen sollten, und dann gibt’s Marken, die als Gütesiegel unbedingt eins anbieten wollen. Solange deren Kunden aber nicht am Fusse einer Bohrinsel zu arbeiten gedenken, könnten sie heute im Prinzip alle drauf verzichten.



Mehr Informationen über die Ploprof, über die Tuna und über die Sea-Dweller.

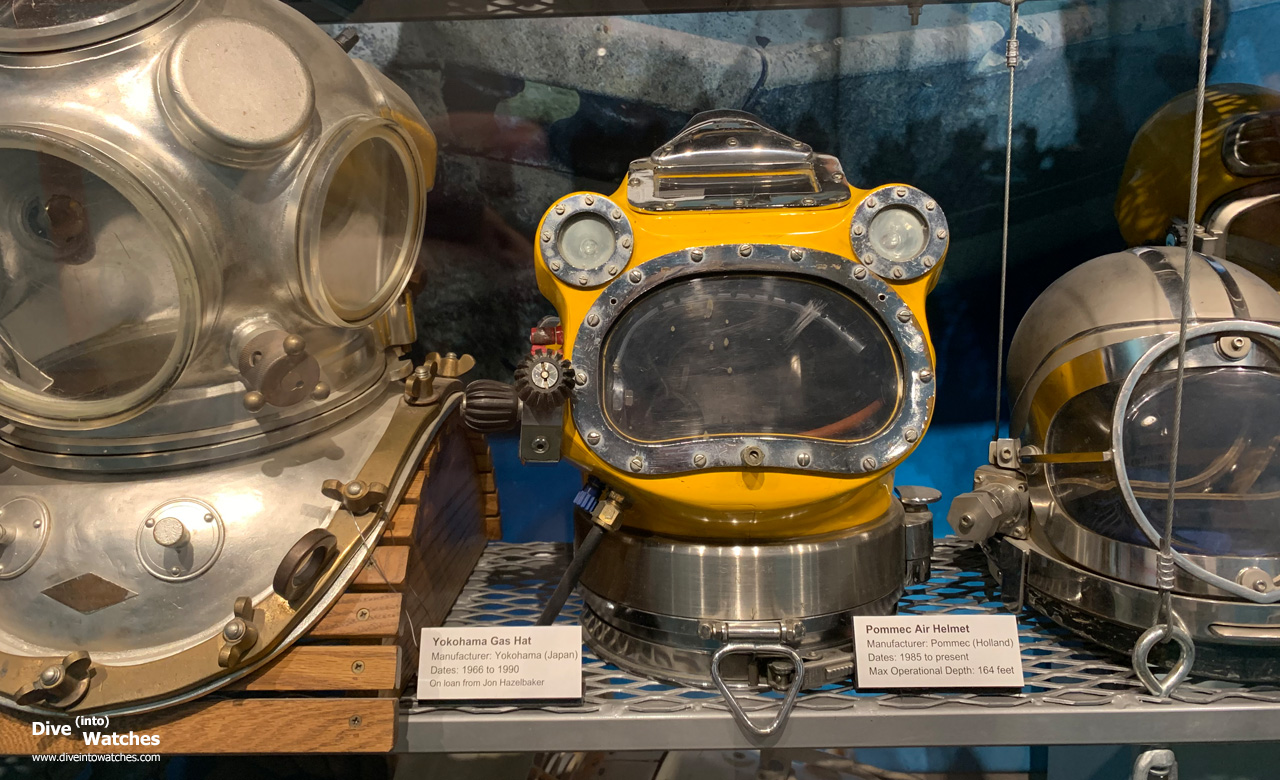
Kommentar verfassen